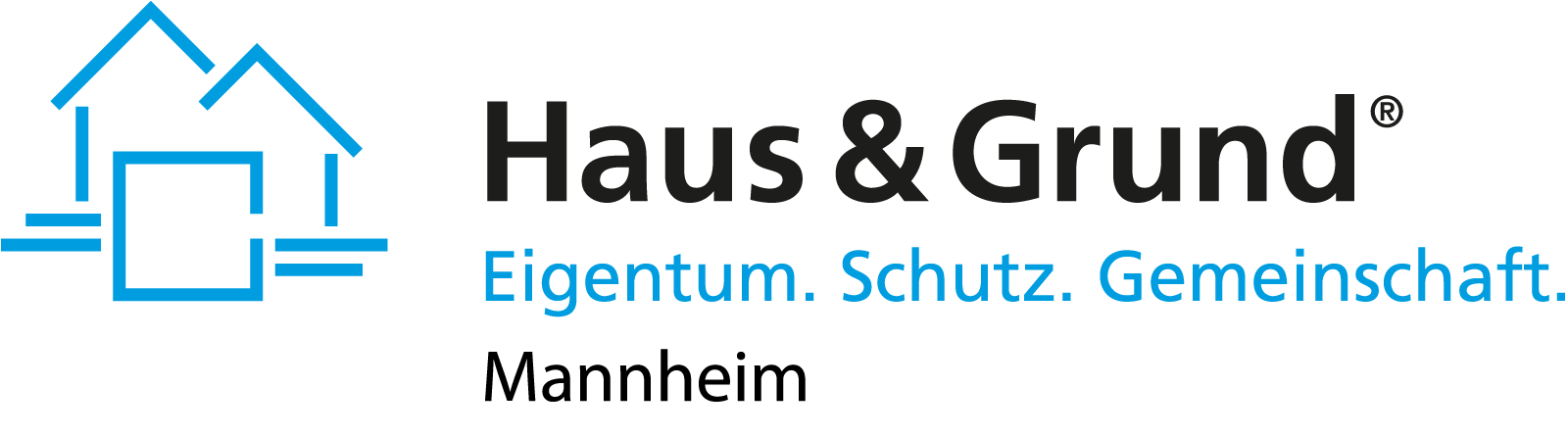
- Verband
- Aktuelles
- Presse
- Topthemen
- Grundsteuerranking 2025
- Aktuelles aus der Lokalpolitik
- Wärme mit Weitblick
- Datenerhebung in Speyer
- Hitzewelle in Deutschland
- Trinkwasserversorgung
- Mannheimer Mietspiegel 2023/2024
- Wechsel des Stromversorgers
- Gründachkataster verfügbar
- Heute schon an Morgen denken
- Das Gas-Aus in Mannheim
- Vorstand im Amt bestätigt
- Vorträge und Seminare
- CO2-Rechner
- Newsletter
- Mitgliedschaft
- Leistungen
- Wir über uns
- Der Rechtsanwalt
- Immobilien GmbH
Hitzewelle in Deutschland
Darf der Mieter bei zu hohen Temperaturen die Miete mindern?
In den vergangenen Wochen hat Deutschland ziemlich geschwitzt. Nicht nur im Büro, sondern auch in den eigenen Wohnungen war es zum Teil zumindest gefühlt unerträglich heiß. Nicht nur Bewohner von Dachgeschosswohnungen konnten ein Lied davon singen. Und viele Menschen haben sich die Frage, ob der Mieter wegen der Hitze die Miete mindern kann?
Das Thema ist juristisch bislang nicht abschließend geklärt. Die Meinungen der Gerichte gehen deutlich auseinander. Gerade bei Dachgeschosswohnungen finden sich sehr unterschiedliche Bewertungen. Während das AG Hamburg hier eine Minderung von 20 % wegen zu großer Hitze akzeptierte (AG Hamburg, Urteil vom 10.05.2006 – 46 C 108/04), musste ein Mieter in Leipzig mit Innentemperaturen von 30 Grad Celsius leben (AG Leipzig, Urteil vom 06.09.2004 – 164 C 6049/04).
Wann ist Hitze ein Mangel?
Generell gilt: Der Vermieter muss die Mietsache in vertragsgemäßem Zustand erhalten (wie er sich bei Mietbeginn darstellte) und etwaige Einschränkungen des Mietgebrauchs beheben. Wurden im Mietvertrag Zusagen zum Zustand oder anderen Eigenschaften der Mietsache gemacht, wie keine Überschreitung einer bestimmten Innentemperatur, so muss der Vermieter auch das während des gesamten Mietverhältnisses gewährleisten und Abhilfe schaffen.
Nun wird sich in aller Regel in keinem Mietvertrag eine Vereinbarung zu etwaigen Höchsttemperaturen finden. Daher kann ein Mieter nicht ohne Weiteres ein Minderungsrecht geltend machen. Hitze in der Mietwohnung ist also nicht per se ein Mangel. Es kommt aber wie so oft im Recht auf die Umstände des Einzelfalls an. Es geht nicht nur darum, über welchen Zeitraum welche Temperaturen erreicht werden oder ob nachts eine Abkühlung möglich ist? Es spielt bspw. auch eine Rolle, ob die einschlägigen Wärmeschutzvorschriften bei der Errichtung des Gebäudes eingehalten wurden.
Bei der Frage, wann durch zu hohe Temperaturen die vertragsgemäße Nutzung der Wohnung erheblich beeinträchtigt wird, orientieren sich manche Gerichte an arbeitsrechtlichen Vorgaben. In den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) findet sich die Angabe, dass die Lufttemperatur 26 Grad Celsius nicht übersteigen soll. Teilweise wird von den Gerichten verlangt, dass die Innentemperaturen mindestens 6 Grad unter den Außentemperaturen liegen müssten (OLG Hamm, Urteil vom 28.02.2007 – 30 U 131/06).
Dieser Maßstab wird dann auf Mietverhältnisse angewendet. Eine Raumtemperatur deutlich über 26 Grad Celsius sei als nicht mehr zumutbar anzusehen, so dass ein Mangel mit einem entsprechenden Minderungsrecht begründet wäre. Ob die Anknüpfung an eine bestimmte Temperatur oder ein bestimmter Temperaturunterschied eine ausreichende Begründung darstellen kann, muss man kritisch hinterfragen. Letztlich verwirklicht sich bei hohen Temperaturen erstmal nur eine Form des allgemeinen Lebensrisikos. Durch den Klimawandel wird es heißer – so ist es leider. Das kann man dem Vermieter nicht vorwerfen; wir müssen alle damit zurechtkommen. Zudem findet sich im Mietvertrag eben keine Zusage einer bestimmten Maximaltemperatur.
Es ist daher an sich nicht zu begründen, warum ein Mieter vom Vermieter Abwehrmaßnahmen gegen die sommerliche Hitze verlangen können soll. Hinzukommt, hat der Mieter selbst alles notwendige und zumutbare unternommen, um eine Hitzeeinwirkung zu reduzieren, also die tagsüber Fenster geschlossen gehalten oder die Jalousien herabgelassen. Vor diesem Hintergrund kann die Annahme eines Mangels also nur Ausnahmefällen plausibel sein, wenn weitere Umstände hinzukommen, die eine andere Bewertung rechtfertigen.
Und wie ist es im Gewerbe?
Im Gewerberaummietrecht gibt es tatsächlich mehr Entscheidungen zum Thema Hitze. Auf der Basis der oben angesprochenen ASR wurde bei zu heißen Räumen ein Mangel bejaht und die Vermieter waren gezwungen, Abhilfe zu schaffen.
Die Koppelung der Frage nach einem Mangel an die ASR erscheint aber fragwürdig. Die Vorschriften richtet sich an den Arbeitgeber, mithin den Mieter und nicht an den Vermieter. Dieser ist lediglich dafür verantwortlich, dass die Mietsache generell für den vertragsgemäßen Gebrauch geeignet ist. Die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften obliegt dagegen allein dem Mieter.
Und auch hier stellt sich wieder die Frage, inwieweit der Mieter alles ihm zumutbare und notwendige getan hat, um seine Mitarbeiter zu schützen. Dazu gehören ggf. Vorgaben zur Kleidung, das Zurverfügungstellen von Wasser, Eis und auch Ventilation/Kühlung.
Kann der Mieter vom Vermieter die Zustimmung zur Durchführung von baulichen Maßnahmen verlangen?
Geht man zurecht davon aus, dass Hitze in der Mietsache grundsätzlich keinen Mangel darstellt, kann der Mieter aber natürlich selbst versuchen, das Problem anzugehen. Er könnte also bspw. selbst eine Klimaanlage installieren wollen.
Dazu braucht er aber in aller Regel die Erlaubnis des Vermieters. Grundsätzlich kann und darf der Mieter bauliche Veränderungen nur vornehmen, wenn ihm der Vermieter zuvor gestattet hat. Da der Hitzeschutz in § 554 BGB (sog. privilegierte bauliche Veränderungen) nicht genannt ist, kann der Mieter sich darauf nicht berufen. Der Vermieter kann grundsätzlich nach freiem Ermessen entscheiden, ob er eine bestimmte bauliche Veränderung duldet bzw. erlaubt.
Beim Hitzeschutz wird es dabei letztlich auf eine Interessenabwägung im Einzelfall ankommen. Der Mieter kann seine Gesundheit gegen das Interesse des Vermieters am unveränderten Erhalt seiner Immobilie ins Feld führen. Hier sollten Vermieter nicht ohne Not zu restriktiv agieren. Wenn der Mieter auf eigene Kosten ein Klimasplitgerät installieren will – wenn dem ansonsten nichts entgegensteht, warum nicht.
Und man sollte natürlich Alternativlösungen im Blick haben. Reicht vielleicht auch ein mobiles Klimageräte mit Abluft nach außen? Ein Sonnenschutz kann ggf. auch ohne Substanzeingriffe auf der Fensterinnenseite installiert werden. Hier sollte man auch im eigenen Interesse flexibel reagieren.
Und was gilt in der WEG?
Auch der Wohnungseigentümer darf nicht einfach ein Klimasplitgerät installieren. Das Durchbohren der Außenwand ist eine erlaubnispflichtige bauliche Veränderung, der die Versammlung der Wohnungseigentümer nicht ohne weiteres zustimmen muss (LG Frankfurt, Beschluss vom 14.08.2023, 2-13 S 5/23). Gegen ein mobiles Gerät, das ohne Substanzeingriffe betrieben werden darf, kann die Gemeinschaft dagegen im Regelfall nichts einwenden.
Muss der Vermieter unabhängig von der Frage eines Mangels die Immobilie modernisieren?
Hier gilt ein ganz klares Nein. Vermieter sind nicht gezwungen, energetische Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen, um die Hitzebelastung für die Bewohner zu reduzieren. Mieter haben prinzipiell keinen Anspruch auf eine Modernisierung, also Verbesserung der Mietsache, sondern nur auf Mangelbeseitigung – so ein solcher denn überhaupt vorliegt.

